Die deutschen Regierungsparteien, und zwar die früheren und die jetzigen, haben immer zum Zwecke der Überwindung dieser unhaltbaren Zustände die Teilnahme an der Regierung, die Teilnahme an der Macht im Staate empfohlen. Der erste Teil dieser deutschen Regierungsparteien hat schon seine Erfahrungen gemacht und nun ist der zweite Teil daran, die zweite Etappe bestehend aus den deutschen Sozialdemokraten und der Arbeits- und Wirtschaftsgemeinschaft. Sie wollten dem sozialen Elend abhelfen, die deutsche Arbeits- und Wirtschaftsgemeinschaft wollte im Wege der Teilnahme an der Regierung die schweren öffentlichen Lasten abbauen. Was haben sie aber in der Praxis erreicht? Weiteraufbau der Lasten, Erhöhung des Staatsvoranschlages, der heuer, wie nachgewiesen ist, bereits die 10-Milliardengrenze überschritten hat. Die Wirtschaftskrise wird immer ärger, die soziale Not immer größer, das Heer der Arbeitslosen steigt an, die Zahl von 300.000 ist bereits erreicht. Die Staatsausgaben wachsen, die Militärausgaben belaufen sich auf 2.500 Millionen Kè, gegen die die deutschen Sozialdemokraten die ganzen vergangenen Jahrzehnte zu Felde gezogen sind und als besonders blutigen Hohn müssen sich die deutschen Sozialdemokraten vom Generalanwalt Dr. Hnídek bieten lassen, daß unter ihrer Mitverantwortung nachgewiesen wird, daß die Militärlasten keine unproduktiven Ausgaben sind. Bitte, schlagen Sie sich Seite 145 des Motivenberichtes auf, mit dem der Staatsvoranschlag dem Plenum vorgelegt wurde.
Hier finden wir die Behauptung, daß von sämtlichen Ausgaben für den èechischen Militarismus nur ein Betrag von 3,243.600 Kc auf unproduktive Ausgaben entfällt. Also nur 3 Millionen auf unproduktive Ausgaben und die anderen Milliardenbeträge auf produktive Ausgaben. Wir sehen, daß die deutschen Sozialdemokraten Jahrzehntelang den Kampf gegen den Moloch Militarismus gepredigt haben, daß sie eine Herabsetzung der ungeheuren Militärlasten gefordert haben, um jene gewaltigen Summen für den Ausbau der sozialen Einrichtungen frei zu machen und um der Wirtschaft zur Hilfe zu kommen, um den Arbeitern nicht nur eine Arbeitslosenunterstützung zu gewähren, sondern um ihnen die gesicherte Möglichkeit zu geben, Brot und Arbeit zu finden, was für die Arbeiter viel wichtiger ist, als eine kleine Erhöhung der Arbeitslosenunterstützung.
Die deutschen Sozialdemokraten haben den jetzt vorliegenden Voranschlag mit dem Motivenbericht voll und ganz zu verantworten, weil sie für ihn stimmen. Aber nicht nur nicht auf wirtschaftlichem, sondern auch auf nationalem und kulturellem Gebiete wurde durch die deutsche Mitarbeit bisher nicht das Geringste erreicht. Vor Monaten haben die deutschen Parteien einschließlich der deutschen Regierungsparteien gemeinsam einen Antrag auf Einsetzung eines Minderheitenausschusses eingebracht. Was war bisher der Erfolg der Einflußnahme der deutschen Parteien? Dieser Antrag ruht noch heute im stillen Kämmerlein. Nicht einmal der Initiativausschuß hat sich mit ihm beschäftigt. Wann werden sich die deutschen Regierungsparteien dazu aufschwingen und ihr Recht fordern, das mindeste Recht, das sie in der Koalition zu fordern haben, daß wenigstens über diesen Antrag abgestimmt, daß er in Verhandlung gezogen wird! Man begnügt sich damit, schöne Reden anzuhören von einer in Aussicht genommenen kulturellen Autonomie. Seit 1926 wird diese kulturelle Autonomie immer wieder den deutschen Regierungsparteien als Butterbrot dargereicht, um ihre Anhängerschaft zu beruhigen. In Wirklichkeit geschieht aber nichts, gar nichts. Im Gegenteil, wir hören nur schöne Reden. Im Vorjahre war es der Finanzminister Dr. Engli und der Obmann des Budgetausschusses Dr. Èerný, die gegen die überzähligen und überflüssigen èechischen Luxusminderheitsschulbauten im sudetendeutschen Gebiete Stellung nahmen, und heute sind es die deutschen Regierungsparteien, die gemeinsam mit den èechischen Parteien auf 10 Jahre im vorhinein den Betrag von 280 Millionen Kè für die Errichtung weiterer èechischer Minderheitstrutzschulen im deutschen Gebiete bewilligen.
Mit Rücksicht auf die kurze, zur Verfügung stehende Redezeit, eine Kürze, die für das Losungswort von der Demokratie, die Diskussion ist, bezeichnend ist, zwingt mich, zum Schluß zu eilen.
Ich kann aber die Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, heute auf einen Vorfall hinzuweisen, den ich bereits im Budgetausschuß angeschnitten habe. Ich habe in der Debatte im Budgetausschuß auf Grund amtlicher Akten nachzuweisen vermocht, daß der èechische Postmeister Cerbousek in Luditz sich des schweren Vergehens der Verletzung des Briefgeheimnisses schuldig gemacht hat. Er wurde beim Bezirksgericht Petschau nur deshalb nicht verurteilt, weil die Anzeige verspätet nach der Verjährungsfrist von einem Jahr überreicht worden war. Die anwesenden èechischen Kollegen haben dieses mein Vorbringen mit Erstaunen gehört und den Sachverhalt für unmöglich gehalten. Ich war der Meinung, daß nunmehr der Postminister energisch einschreiten wird. Er ist auch eingeschritten. Er hat in einem Briefe zu diesen meinen Ausführungen Stellung genommen, aber darauf hingewiesen, daß er auf Grund des von mir angezogenen Wortlautes des Urteils des Petschauer Bezirksgerichtes keinen Anlaß finde, irgendwie gegen den Postmeister Cerbousek einzuschreiten. Sie werden es begreiflich finden, wie ein solches Verhalten der obersten Postbehörde sich auswirken muß, und Sie dürfen sich nicht wundern, wenn Luditz, Marienbad und andere Fälle ununterbrochen ihre Fortsetzung finden.
Ich komme zum Schlusse. Ich möchte darauf hinweisen, daß das, was ich hier kurz geschildert habe, die segensreichen Auswirkungen sind, der auf den Haßverträgen des Jahres 1919 aufgebauten Innen- und Außenpolitik dieses Staates, der verfehlten Außenhandelspolitik, die statt Handelsverträge mit jenen Staaten abzuschließen, mit denen wir in innigem wirtschaftlichen Verkehr stehen, so mit Deutschland und Deutschösterreich, daß man sich lieber mit den Gedanken beschäftigt und abgibt, wie man im Interesse Frankreichs hier im Osten und Südosten Deutschlands eine Mächtegruppierung durchführen kann, die jeweils bereit ist, die Hegemoniestellung Frankreichs zu fördern und zu stützen. Statt darauf hinzuarbeiten, im Interesse einer wirklichen Befriedung Europas größere Zollgebiete zu schaffen, erklärt der angebliche Friedensfreund Dr. Bene, daß für ihn schon die Schaffung einer Zollunion Deutschland und Deutschösterreich den Krieg bedeutet. Das sagt ein Mann, der sich auf eine Regierungskoalition èechischer und deutscher Parteien stützt.
Verehrte Anwesende! Sie mögen heute noch darüber lächeln, ich erkläre Ihnen aber: Dem Volkstumgedanken gehört die Zukunft, und wenn die Regierenden in den einzelnen Staaten sich nicht endlich dessen bewußt werden, daß sie auf die Dauer ihren Völkern dieses heiligste Naturrecht der Selbstbestimmung nicht vorenthalten können und dürfen, dann werden sich eben die Völker dieses Recht selbst zu erkämpfen wissen. Wir und mit uns alle, die der Erhaltung eines wahren Friedens dienen wollen, fordern daher mit aller Energie die Revision der Unfriedensverträgen des Jahres 1919, die Erfüllung der Völkerbundpaktbestimmungen in der Richtung der Abrüstung. Wir fordern die Grenzrevision auf Grund der ethnographischen Verhältnisse. Wir fordern den Ausbau in wirtschaftlicher Beziehung zwischen den dann so national befriedigten Staaten. Denn nur auf diesem Wege einer wahren Demokratie können wir zu einer friedlichen Entwicklung der Völker Europas kommen. Meine Herren, in diesem Staate und in diesem Hause wird so viel und so oft von Demokratie gesprochen. Und was geschieht in Wirklichkeit? Ist jemals die Demokratie so bloßgestellt worden, wie es gerade hier von den deutschen und èechischen Regierungsparteien geschieht, durch die Gutheißung der èechischen Innen- und Außenpolitik? So fördern z. B. die deutschen Sozialdemokraten gemeinsam mit den èechischen Sozialdemokraten eine Innen- und Außenpolitik dieses Staates, aufgebaut auf der sogenannten Nationalstaatsgrundlage, gestützt auf das Säbelregime der befreundeten Bundesstaaten Polen, des Polens Pilsudskis, der nicht mit Unrecht in den sozialdemokratischen Zeitungen als der Mörder der Demokratie bezeichnet wird, gestützt auf das südslavische Säbelregiment. Das sind die engeren Bundesgenossen der èechoslovakischen Innenund Außenpolitik, die von den deutschen Sozialdemokraten hier in diesem Staate gestützt und gefördert wird.
Koll. Støíbrný hat heute versucht, uns Deutschen in diesem Staate eine Belehrung zu erteilen, und er hat sich auf den Standpunkt gestellt, daß wir Sudetendeutschen in diesem Staate eine Minderheit seien und zufrieden sein müssen, wenn es uns besser geht als den Deutschen in Südtirol. Meine Herren, diese anmaßende Äußerung des Koll. Støíbrný darf nicht unwidersprochen bleiben und mit aller Energie müssen wir ihm antworten, daß wir 3 1/2 Millionen Sudetendeutsche, von denen mehr als 86% auf geschlossenem deutschen Heimatboden wohnen, daß wir auf diesem geschlossenen deutschen Heimatboden die Mehrheit sind, u. zw. eine 99% ige Mehrheit, und daß wir es uns verbieten, von uns als Minderheit in seinem Sinne zu sprechen. Wir sind keine Minderheit, wir sind bodenständiges Volk auf unserem Heimatboden, und wir sind gegen unseren Willen, gegen unseren laut und feierlich verkündeten Willen in diesen Staat hineingepreßt worden. Wenn uns Herr Støíbrný und die, die ihm Beifall klatschten, nicht haben wollen, mögen sie uns eben freigeben, aber freigeben mit unserem Heimatboden. Koll. Støíbrný hat darauf hingewiesen, daß wir zufrieden sein müssen, daß es uns nicht so geht wie den Deutschen in Südtirol.
Das sagt derselbe Herr Støíbrný,
der seine Anhänger vor wenigen Wochen auf die Prager Straße rief,
um gegen das Schicksal der slovenischen Minderheit in Italien
zu protestieren. Woher wollen Herr Støíbrný und seine Gesinnungsfreunde
das moralische Recht nehmen, die Lage der Slovenen zu beklagen,
wenn er es wagt, uns die Worte, die ich vorhin zitiert habe, entgegenzuschleudern?
Das ist nicht Wahrheit, das ist nicht Gerechtigkeit, das ist auch
nicht Demokratie. Demokratie, Wahrheit und Gerechtigkeit erfordern,
daß man es jedem Volke ermöglicht, auf Grund seiner Entschließung
zu leben, auf Grund der Selbstverwaltung seine Angelegenheiten
zu regeln und sein staatliches Schicksal selbst zu bestimmen.
Wir fühlen mit den Slovenen in Italien, wir fühlen das furchtbare
Schicksal, das auch die armen Slovenen dort erleben, wir fühlen
aber infolge der innigen Blutströme, die zu den Deutschen Südtirols
fließen, umsomehr das furchtbare Schicksal der Deutschen Südtirols.
Für uns gibt es keine Minderheit in diesem Sinne, keinen abgetrennten
deutschen Volksteil, der preisgegeben werden könnte, für uns gibt
es nur ein großes deutsches Volk auf geschlossenem deutschen mitteleuropäischem
Gebiete. Möge heute noch Herr Støíbrný triumphieren, daß
er die Macht hat, auch gegen uns Deutsche hier die Prager Straße
zu mobilisieren. Ich appelliere an die anständig Denkenden Ihres
Volkes, an das stolze Nationalbewußtsein Ihres Volkes, das Sie
während des Weltkrieges veranlaßte, die gerechte Forderung nach
dem Selbstbestimmungsrechte der Völker zu erheben, für dieses
zu kämpfen und zu bluten. Damals haben Sie mit bewunderungswürdiger
Treue und Aufopferung die Gesetze ihres angestammten Volkstums
höher eingeschätzt als die Gesetze des damaligen Staates. Der
anständige Teil des èechischen Volkes muß es uns nachfühlen, daß
uns dasselbe Recht zuerkannt werden muß, daß wir mit derselben
heißen Liebe an unserem Volkstum hängen und daß wir ohne Rücksicht
auf die schweren Jahre der Gegenwart ausharren werden, bis auch
für uns der Tag der Befreiung heranbricht. Weil die gesamte èechische
Nationalstaatspolitik und die jetzige deutsch-èechische Koalitionspolitik
diesen Grundsätzen widerspricht, lehnen wir mit aller Entschiedenheit
das hier vorgelegte Budget ab.(potlesk)
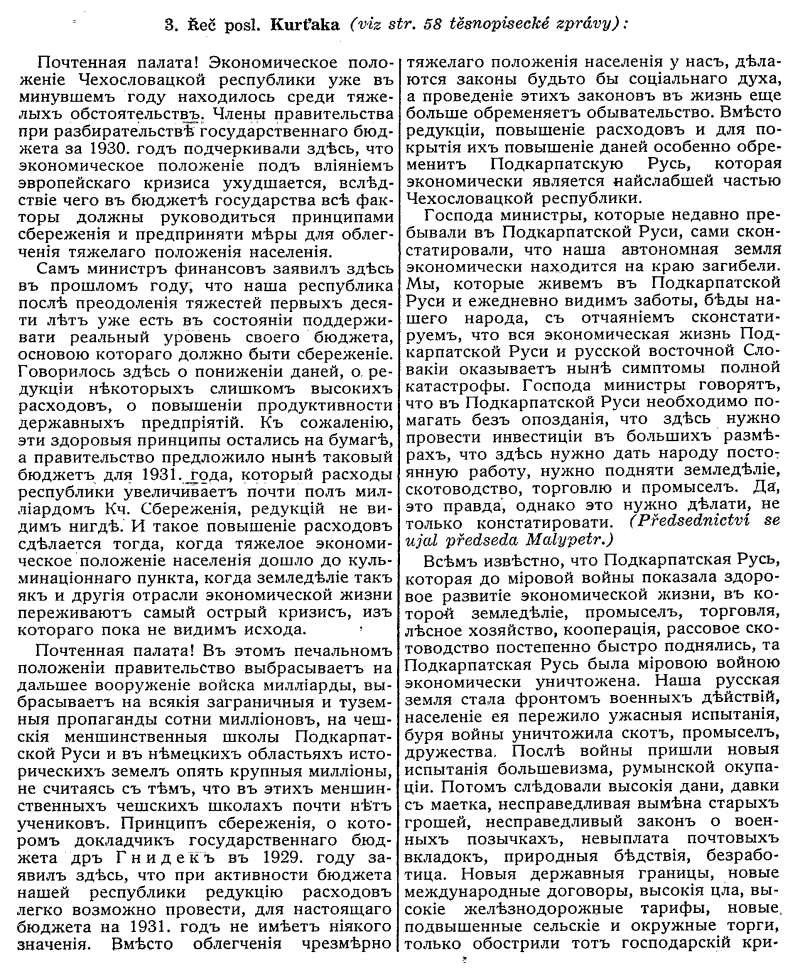
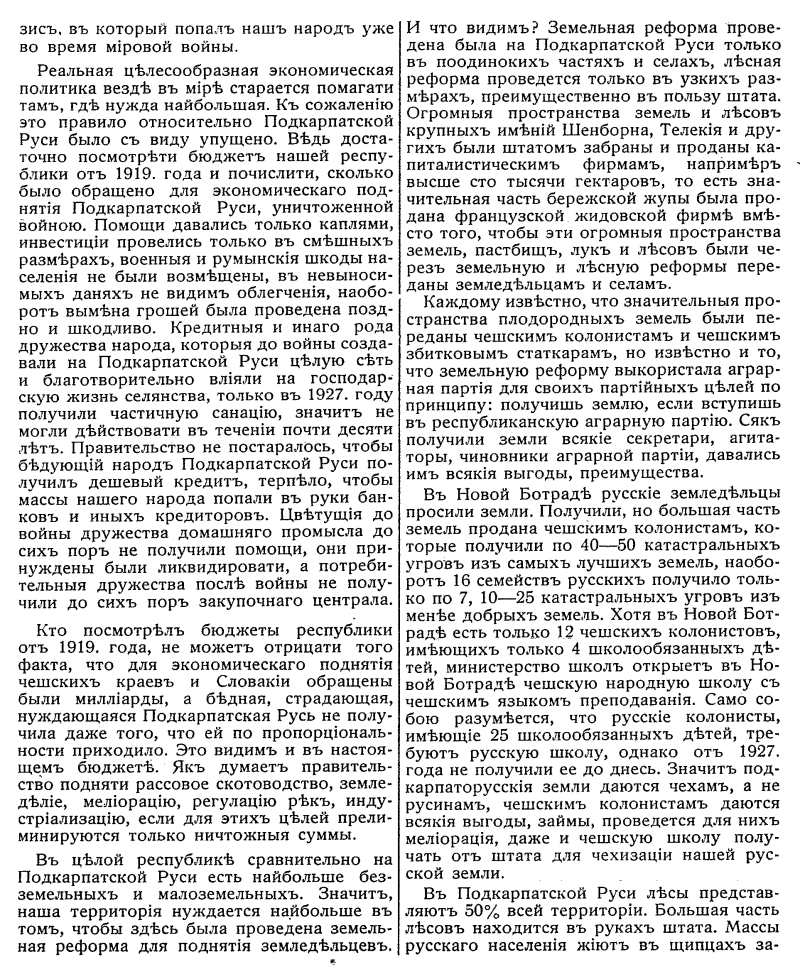
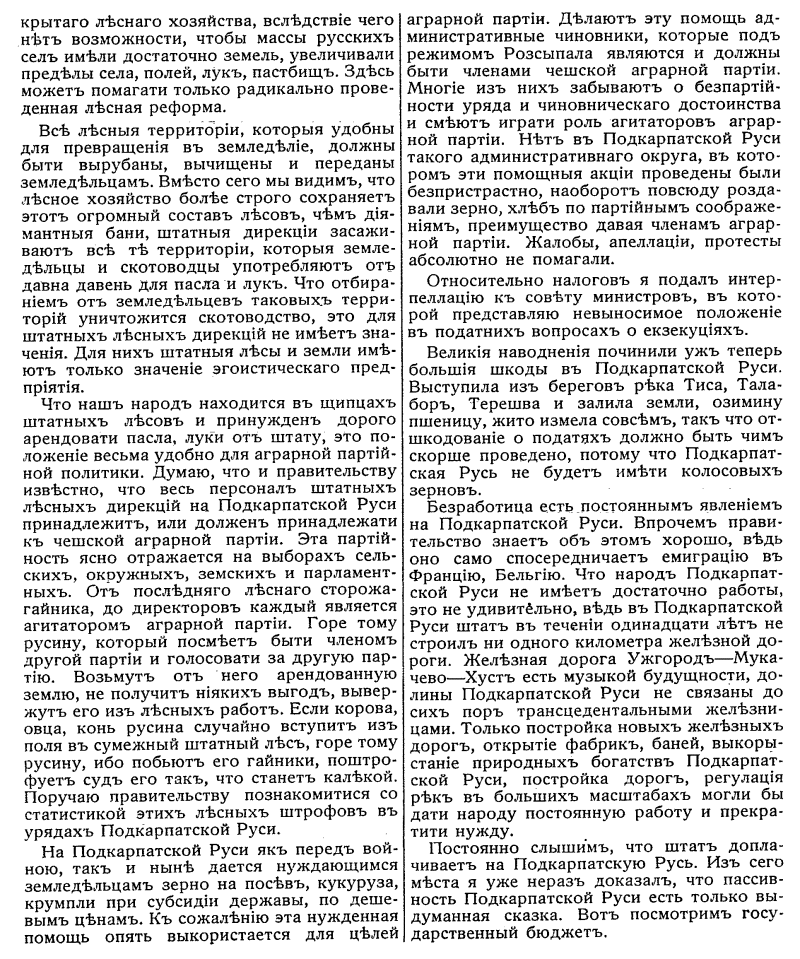

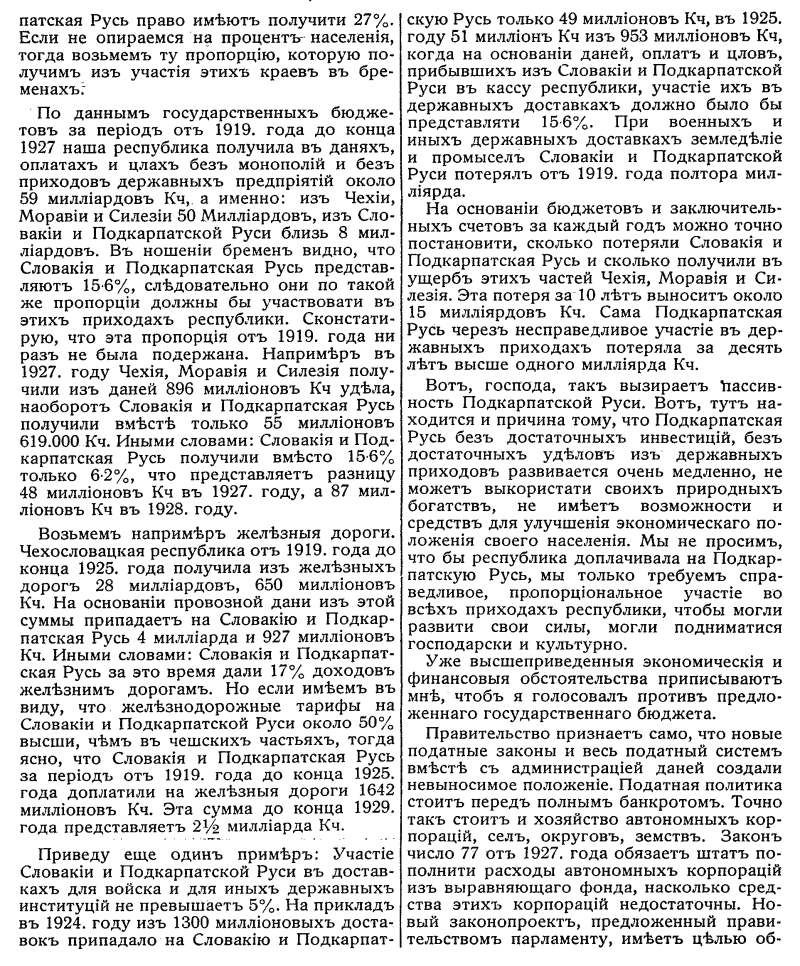


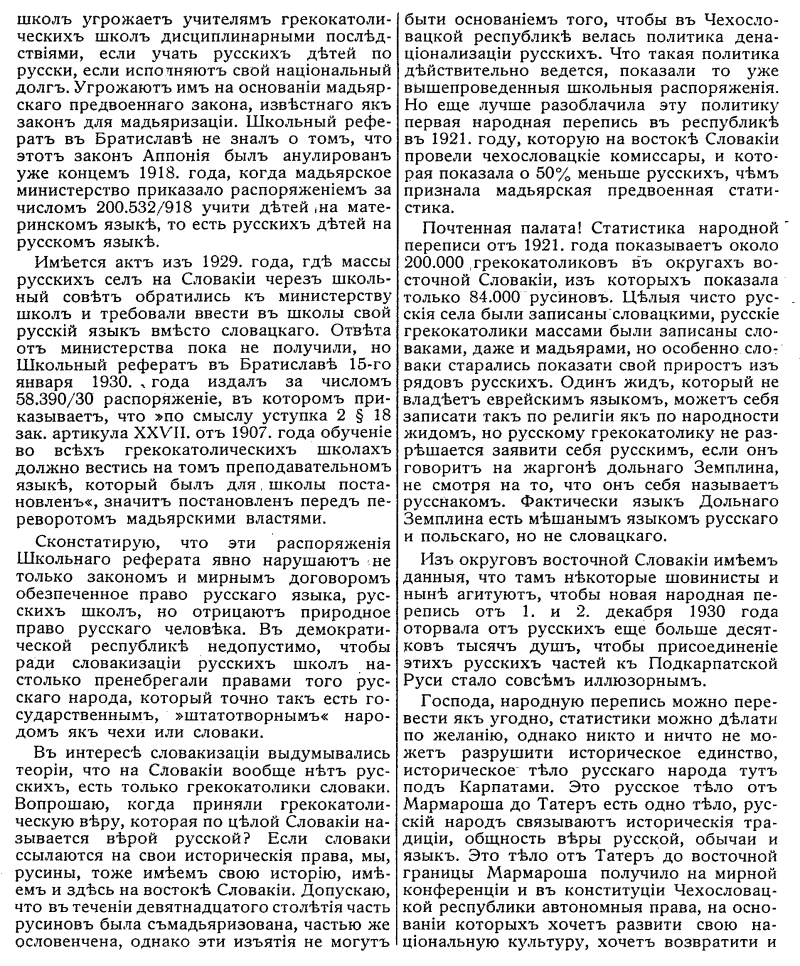
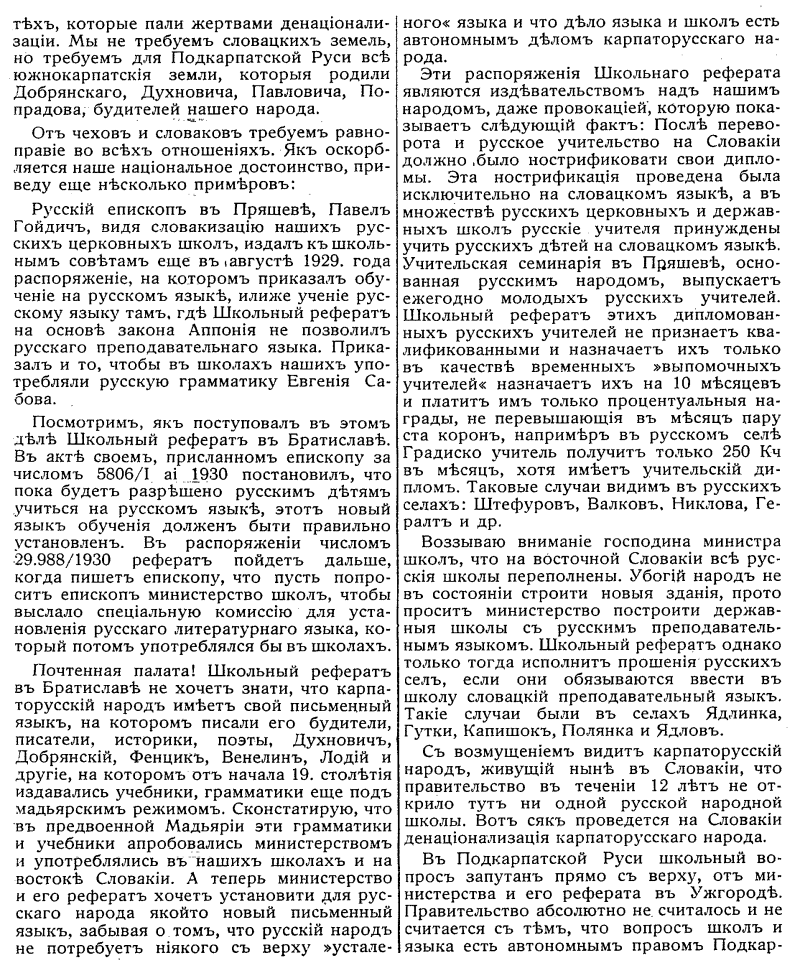
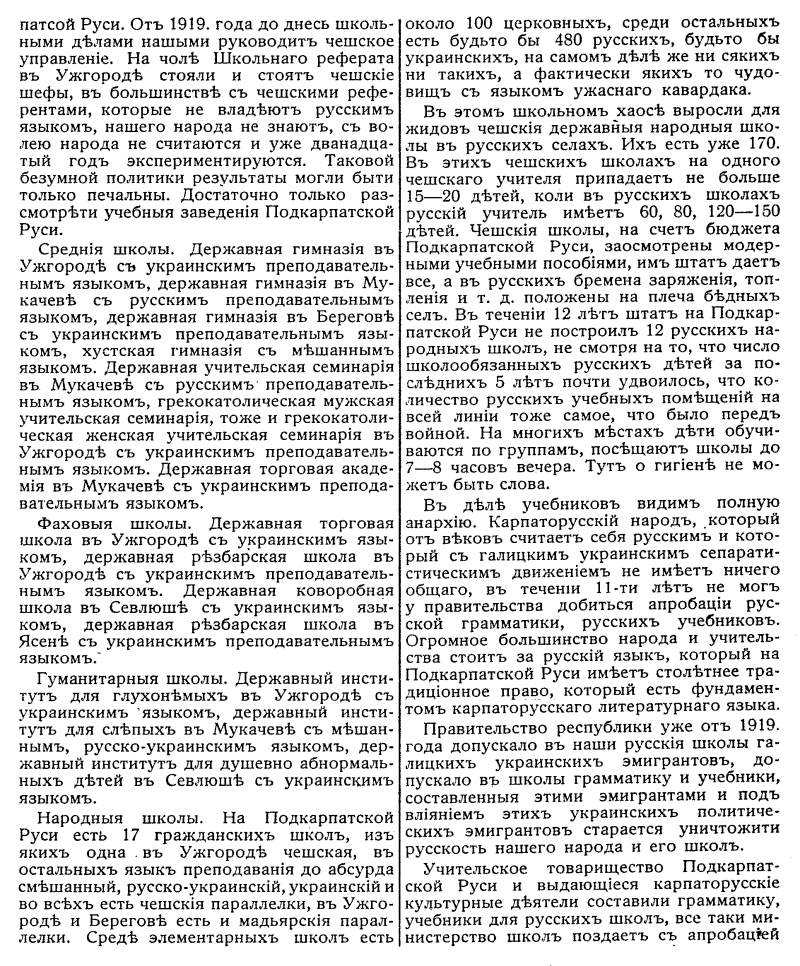
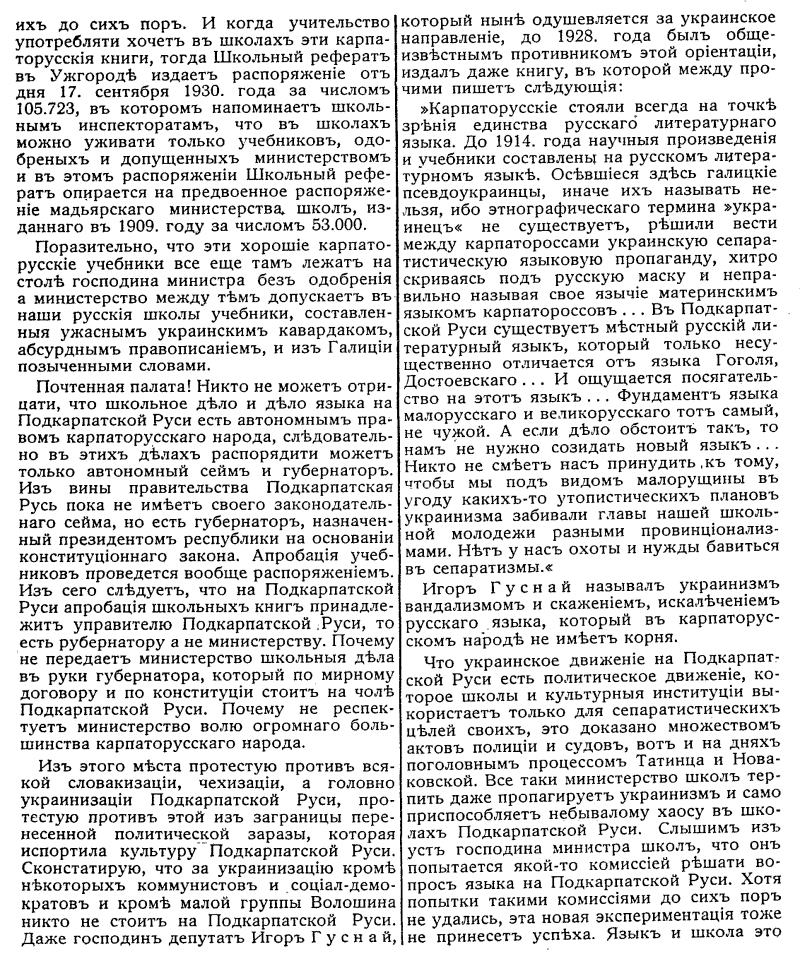
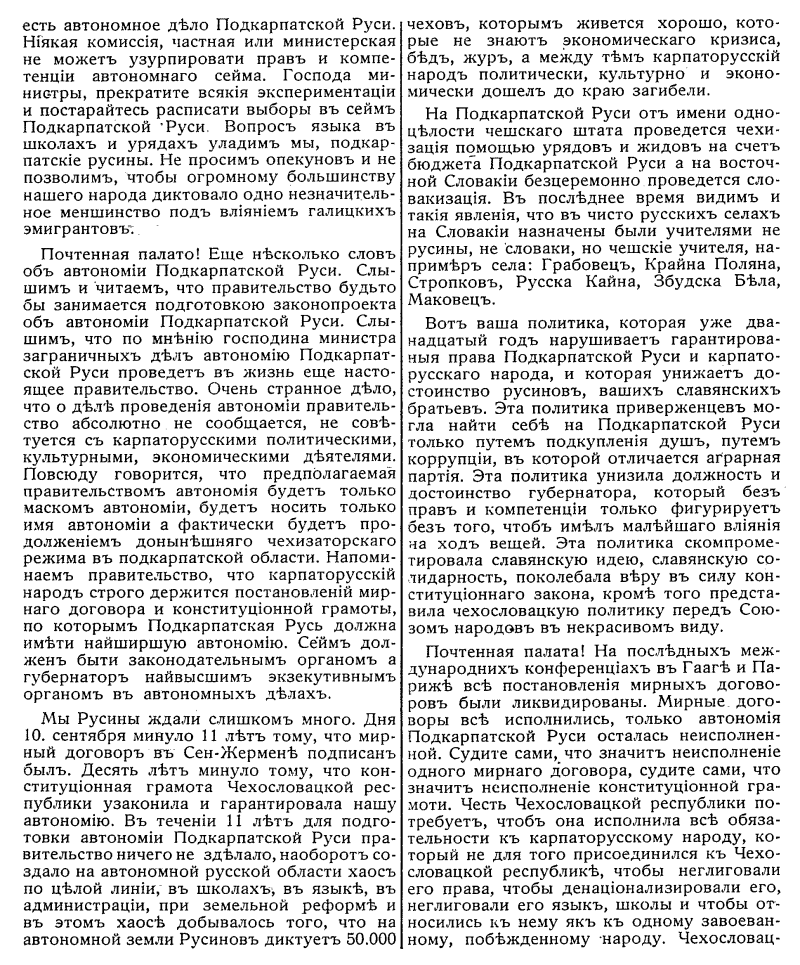
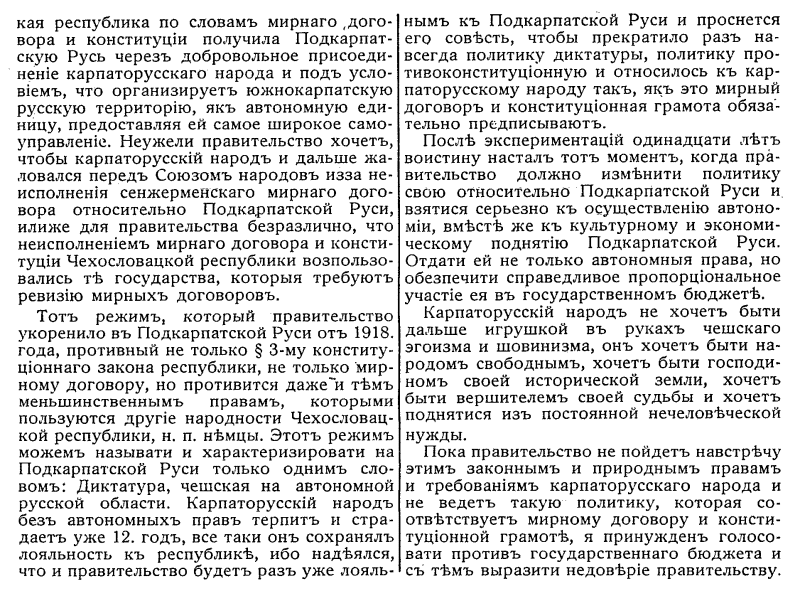
Verehrte Anwesende! Wer einmal die Geschichte des èechoslovakischen Parlaments schreiben wird, wird von schweren Zweifeln geschüttelt werden. Der zukünftige Geschichtsschreiber wird nicht leicht entscheiden können, ob dieses Parlament tatsächlich ein konstitutionelles Gebilde ist. Äußerlich ähnelt es den Parlamenten der westlichen Demokratien, innerlich hat es aber ein ganz anderes Gesicht, sicher kein konstitutionelles. Es ist etwas, was sich die Èechen zu dem Zwecke zurechtgelegt haben, um ihre Vorherrschaft unter Wahrung der leeren Formen eines vorgetäuschten konstitutionellen Lebens sich für alle Zeiten zu sichern. Es fehlt dem Parlament die konstitutionelle Seele, aber auf diese kommt es ja der herrschenden Nation nicht an. Der konstitutionelle Schein ist gewahrt, die Oberflächlichkeit konstatiert die konstitutionelle Form: die geist- und seelenlose Abstimmungsmaschine liefert prompt die Gesetze, welche die èechischen Machthaber zur Rechtfertigung ihrer Handlungen benötigen, und das genügt. Bürokratie und Armee erhalten durch dieses System ganz sicher die zu ihrem Gedeihen nötigen materiellen Mittel; der Wille, das Interesse der Staatsbürger ist nicht wichtig, höchstens das materielle Interesse eines Teiles der Bevölkerung, jenes Teiles, aus welchem sich die Machthaber rekrutieren. Aus diesen Gründen besitzt das Parlament wenig Autorität und durch diesen Gedankengang wird auch jene Interesselosigkeit verstanden werden können, welche selbst die meisten Abgeordneten dem Parlament gegenüber zur Schau tragen. Überzeugung, Wissen, Argumente finden keine Beachtung. Wozu sich abmühen, es ist ja eh' umsonst, das Parlament bleibt leer, auch während der Debatte über das Staatsbudget. Staatsbudgetdebatten sind in konstitutionell funktionierenden Parlamenten hohe Feiertage des öffentlichen Lebens, welchen auch breite Schichten der Bevölkerung großes Interesse entgegenbringen. Bei uns gähnt der Sitzungssaal leer auf die Redner. Die Debatte über den Staatsvoranschlag wird seitens der Machthaber als nicht zu umgehende Formalität betrachtet, welche durch den Maulkorb von 5 bis 10 Minuten zugestandener Redezeit für je einen Redner zu einer Komödie herabgedrückt wird. Unter solchen Umständen hat auch für die Opposition die Debatte über den Staatsvoranschlag nur mehr das Interesse, daß es möglich ist, die unerquicklichen Zustände in unserem Staate einer allgemeinen Kritik zu unterziehen.
Die lehrreiche Kritik ist diejenige, die durch Rückschau zur Gegenwart gelangt. Es ist der 28. Oktober 1918. Die österreichischungarische Monarchie ist zerschlagen, die Èechen jubeln, der neue Staat erhält 13 Millionen Einwohner und ein Gebiet reich an Bodenschätzen und Industrieen. Trotz Kriegsund Hungerjahre ist der frühere Wohlstand Dank der schonenden Steuerbehandlung seitens des früheren Regimes beinahe unangetastet. Bald soll es anders werden. Diejenigen, die sich um den neuen Staat verdient gemacht haben, müssen entlohnt werden und dazu ist viel Geld notwendig. Die eigenen Leute werden gewarnt, damit sie keinen oder keinen zu großen Schaden erleiden und dann kommen nacheinander die Geldabstempelung, die Vermögensabgabe, die Bodenreform, die Entwertung der Kriegsanleihen. Es entsteht eine ungeahnt zahlreiche Bürokratie und eine gleichfalls überdimensionierte Armee. Die Folge ist, daß ungezählte tausende von Existenzen zugrunde gehen. Sie gehören zum großen Teile den nationalen Minderheiten an.
Aber die Dimensionen der neuen Einrichtungen erfordern noch weitere Mittel, und so muß die Steuerschraube fester angezogen werden, mit der Zeit bis zu 100% der Leistungsfähigkeit. Doch es tut nichts. Was man so nennt, wie èechischer Genius, das wöllbt stolz die patriotische Brust. Denn man behauptet, daß man aus der Republik eine wirtschaftliche Oase gemacht hat. Alles um die Republik herum geht zugrunde. Deutschland, Österreich, Ungarn werden vom Inflationsfieber geschüttelt. Polen und Rumänien wackeln, aber felsenfest steht da die Wirtschaft der eigenen Republik. Die Valuta ist stabilisiert, man geht sogar daran, die Goldvaluta einzuführen. Alle Blicke sollen auf die Republik als ein wirtschaftliches Wunder, geschaffen durch èechische Patrioten, gerichtet werden, und gerichtet bleiben. Der èechische Blätterwald rauscht vor Vergnügen, verkündet laut die innere Konsolidation, die äußere Autorität, die steigende Macht, mischt sich so wie der Außenminister in die inneren Angelegenheiten der besiegten Nachbarn, rasselt oft mit dem Säbel, denn alles muß so bleiben, wie es ist, und wehe dem, der sich anderen Ansichten zu huldigen traut, als welche der allmächtige Außenminister der Republik vorzuschreiben geruht. Außerdem verkündet der Herr Außenminister sowohl im In- wie im Auslande: die nationalen Minderheiten sind befriedigt, haben sogar mehr erhalten als ihnen gebührt, und die demokratische Konsolidation findet darin ihre politische Krönung, daß ein Teil der deutschen Minderheit, ohne nationale Bedingungen zu stellen, in die èechische Regierung eintritt. Und die Mentalität, welche alle èechischen politischen Träume in die Wirklichkeit umgesetzt hat und welche sich schmeichelt, daß, wenn alles ringsum zugrundegeht, die eigene wirtschaftliche Oase ungehemmter Weiterentwicklung entgegengehen muß, merkt nicht, daß sie wirtschaftliche Rechenfehler zu machen beginnt.
Die Einführung der Sozialversicherung und die Inanspruchnahme der Steuersubjekte bis zur äußersten Grenze der Leistungsfähigkeit beginnen, die Industrie konkurrenzunfähig zu machen. Aber die Freude am zehnjährigen Jubiläum des Bestandes des Staates verscheucht alle hie und da aufsteigenden Bedenken, und im Lichte der Millionen von verbrannten Kerzen, im Rausch der abertausende Jubiläumsreden, im Gewoge der Paraden und Aufmärsche und bei den Klängen der mitwirkenden Blechmusiken darf man sich keinen anderen als rosigen patriotischen Gedanken hingeben. Doch nachdem der Jubiläumsrausch vorüber war, mußte man merken, daß die wirtschaftliche Oase in einem Leerlauf zu übergehen droht. Die Methode, nur aus der Wirtschaft nehmen, bis zu 100% nehmen, als wenn kein Rückschlag möglich wäre, hat schon an und für sich die Kaufkraft vieler eigener Staatsbürger geschädigt und als die Wirtschaftskrise auch in die Republik Eingang gefunden hat, was jeder denkende Wirtschaftspolitiker voraussehen mußte, waren hier sozusagen keine Reserven, und mit einem Male war die wirtschaftliche Oase dahin. Sandige Sahara verschüttete die ärmere Slovakei beinahe schon ganz, in den historischen Ländern verbreitet sich auch zusehens der unfruchtbare Sand, um auch hier den wirtschaftlichen Wohlstand zu bedecken.
Wie vom Schlage gerührt tat die rot-grüne schwarz geäderte Koalition vorerst nichts gegen die drohende Gefahr. Fasziniert, von der Idee der als ewig erträumten wirtschaftlichen Oase wollte sie nicht an den Ernst der Lage glauben und wartete auf ein himmlisches Wunder. Doch anstatt des Wunders entwickelte sich die Krise ins Tragische. Man einbekennt heute 300.000 Arbeitslose. Aber diese Statistik ist falsch, denn darin sind die nichtorganisierten landwirtschaftlichen Arbeiter nicht inbegriffen und auch nicht die kundenlosen Gewerbetreibenden und Kaufleute, alles in allem, zuverlässig ebenfalls 300.000 Familienhäupter. Und vor der Türe steht ein in seiner Härte noch unbekannter Winter. Die Entwicklung ist vorauszusehen. Wenn nicht entweder die Krise abflaut, oder nicht Vorsorgen gegen den Hunger der nichtunterstützten Arbeiter erfolgen, wird es im Winter zu einem moralischen Debakle kommen müssen, das seine Auswirkung im riesenhaften Anwachsen von Diebstählen und Räubereien finden muß, von allen anderen möglichen Konsequenzen gar nicht zu reden.
Was bisher zur Verhütung der Folgen des weiteren Umsichgreifens der Arbeitslosigkeit geschehen ist, ist nicht einmal der sprichwörtliche Tropfen im Meere, wobei bemerkt werden muß, daß auch dieser Tropfen zumeist in die historischen Länder gefallen ist, östlich der March; wo das Elend viel größer ist, ist auch von diesem Tropfen recht wenig zu merken. Ich frage: Besitzt die Republik noch solche Reichtümer, daß sie ungestraft auf die Erkenntnis, daß die Arbeitskraft das höchste Gut und die Arbeitslosigkeit eine Verschwendung ist, verzichten kann? Auf die Warnung, daß man dem leeren Magen umsonst Mäßigkeit predigt und daß der Hungrige nicht mit den Konsequenzen triebhafter Handlungen rechnet, ist wohl am Platze. In der Seele der Arbeitslosen hockt die Verzweiflung, um das nichtverdiente, ungerechte Schicksal abzulehnen. Für die allgemeine Wirtschaftskrise ist die Regierung nicht allein verantwortlich, aber daß sich die Verhältnisse derart entwickeln konnten, dafür trifft sie voll die Schuld.
Die Opposition hat schon seit Jahren auf die Unrichtigkeit der Regierungsmethoden hingewiesen und hat die Änderung der Wirtschaftspolitik, eine schonende Steuerpolitik, Sparsamkeit im Heeresbudget und in der Verwaltung, Änderung der Behandlung der Minderheiten und Änderung in der Außenpolitik gefordert. Man hätte auch hiedurch nicht der wirtschaftlichen Krise entgehen können, aber sie hätte sich leichter ertragen lassen. Was nützt es, daß die Republik mit weit entlegenen, wirtschaftlich kaum in Betracht kommenden Staaten Handels- und Rechtshilfeverträge abgeschlossen hat? Wo kaum gegenseitige Beziehungen bestehen, ist es wirklich keine Kunst, Handels- und Antikriegsverträge abzuschließen. Aber mit Deutschland, mit Österreich, mit Ungarn, sogar mit Jugoslavien bestehen noch keine stabilen Handelsverträge, und es ist erst kürzlich gelungen, mit Rumänien zu einem Handelsvertrage zu gelangen. Es steckt auch da ein Rechenfehler, u. zw. der, daß man auf den wirtschaftlichen Zusammenbruch der Nachbarn spekuliert hat, und daß man sogar alles tat, um diesen herbeizuführen, damit man dann umso leichter im Trüben politisch fischen könne. Man hat solange herumgelistet, bis das Mittel den Zweck umgebracht hat; die eigene wirtschaftliche Oase verschwand.
Es pflegt immer so zu kommen, wenn einer überklug sein will. Außenminister Bene, geblendet durch seine Erfolge im Jahre 1920 bei den Friedensvertragsverhandlungen, glaubte, mit denselben Schachzügen auch die Wirtschaft der, wenn auch nicht durch seine Nation besiegten Nachbarn zu überlisten. Doch bei den Handelsvertragsverhandlungen sind einander gleichgestellte Partner gegenübergestanden, und da mußte der Versuch der Überlistung durch den Außenminister scheitern. Außenminister Bene hat nämlich nicht gewußt, daß nach einem ungarischen Sprichworte es bloß einmal einen Hundejahrmarkt in Buda gegeben hat. Hätte er ungarisch gekannt, hätte er es wissen können und hätte nicht auf einen zweiten spekuliert.
Die bisher befolgte Außenpolitik in ihrer wirtschaftlichen Richtung war also falsch, sie war nämlich mit politischen Nebenzielen infiziert und so mußte sie kläglich enden und brachte das Land in einen vertragslosen Zustand gerade zur Zeit der Wirtschaftskrise. Aber auch sonst bewegt sich die Außenpolitik in falscher Richtung. Seit dem Entstehen der Friedensverträge verkündet bis heute Dr. Bene die Unverletzlichkeit und Heiligkeit derselben. Er scheint die letzten Jahre geschlafen zu haben und hat den richtigen Weg zur Wirklichkeit verloren. Er lebt in der Illusion der Ewigkeit, sonst müßte er merken, daß sich die umgebende Welt zu verändern beginnt. Herr Bene merkt nicht, daß sich schon alles, was von Gewicht ist, selbst in Frankreich - außer Poincarée auf die Revision der Friedensverträge vorbereitet; merkt nicht, daß gerade die Friedensverträge eine Situation heranreifen ließen, die als untragbar empfunden wird und gebessert werden soll. Mit einem Wort: die Friedensverträge werden langsam revisionsreif. Wenn aber der Außenminister die sich vollziehende Änderung nicht merken will, dann bringt er sein Land sukzessive in Widerspruch mit der ganzen Welt. Wenn er heute noch die Unveränderlichkeit der Friedensverträge beschwört, dann ist er ein Tenor, der falsch singt, und sonderbarer Weise: die Èechen, die sonst gute Musiker sind, merken nicht, daß ihr außenministerieller Tenor falsch singt. Die Gedanken stehen nicht still und es wäre also im Interesse des Landes, sich mit der Idee der Abänderlichkeit der Friedensverträge zu befassen und darauf seine Entscheidungen zu bauen.
Der einzig kühldenkende Kopf in dieser Richtung ist ohne Zweifel Prof. Masaryk, der sich schon seit vielen Jahren bemüht, einer friedlichen Revision das Wort zu reden. Die langjährige methodische Beschäftigung mit der Wissenschaft hat ihm die logische Denkungsart bewahrt und befähigt ihn, ála longue zu denken. Es ist ganz sicher, daß ihn die Erkenntnis jener Gefahren, die seinem Lande aus der Anklammerung an die Unantastbarkeit der Friedesverträge erwachsen können, zu seiner wiederholt geäußerten Meinung geführt hat. Er ist auch bisher der einzige, der unter den Èechen den Mut gefunden hat auszusprechen, daß er geneigt wäre, mit Ungarn über Grenzänderungen zu verhandeln. Er hat zwar unter dem Drucke seiner durchaus nicht aus Universitätsprofessoren bestehenden Regierung immer wieder sich selbst berichtigt, doch aus dem Umstande, daß er wiederholt ähnliche Äußerungen getan hat, muß geschlossen werden, daß es sich bei ihm hiebei um logische Konsequenz handelt. Insbesondere konkret hat sich der Staatschef heuer im Sommer geäußert. Und obwohl auch diesmal der Oberuniversitätsprofessor Udral die geäußerte Meinung Professors Masaryk einfach richtig gestellt hat, steht demgegenüber die Äußerung des Inteviewers Major Newman, der geg nüber Udral folgendes der Öffentlichkeit bekanntgab: "Hinsichtlich der Interviews, welches Präsident Masaryk mir am 13. August im Schlosse von Klein Topolèany zu gewähren die Güte hatte, muß ich betonen, daß der Wortlaut, den ich der London General Press zur Veröffentlichung übergab, nach meinem besten Wissen und Gewissen wahrheitsgetreu die Meinung wiedergab, die Präsident Masaryk im besten Englisch vor mir geäußert hat. Der Präsident stellte dabei nicht das Verlangen, daß das Interview vorher seiner Genehmigung unterbreitet werden soll. In der von der èechoslovakischen Regierung veröffentlichten Berichtigung ist die Meinung, die der Präsident über den polnischen Korridor und über Ungarn vor mir auseinandersetzte, nicht richtig wiedergegeben. Ich möchte noch hinzufügen, daß es immer mein ernstes Streben war und ist, meinen Lesern die Wahrheit im strengsten Sinne zu eröffnen, wie ich denn glaube, daß dem Zweck der Presse wie überhaupt der Politik aller Länder auf diese Weise am besten gedient ist." Ja, Herr Newman, Sie haben vollständig recht. Die mannhafte und glaubwürdige Erklärung Newmans spricht nicht gegen Professor Masaryk, nur gegen den falschen außenpolitischen Horizont seiner Regierung. Professor Masaryk will keinen Krieg, wir bürgerliche Minderheiten wollen auch keinen Krieg, in welchem gerade wir die größten Opfer bringen müßten. Natürlich hängt die Entscheidung über außenpolitische Fragen nicht von den Minderheiten ab, aber auch unsere Pflicht ist es zu fordern, daß sich das Verhältnis zu den Nachbarn, auch zu Ungarn bessere.
Außenminister Bene scheint seine Aufgabe Ungarn darüber dahin aufgefaßt zu haben, das Verhältnis zu Ungarn ständig im Stadium der Spannung zu halten und hiezu war ihm jedes Mittel, sogar die Politik des auf die Hühneraugentretens, erwünscht. Als noch nicht lange her der Staatsgouverneur Ungarns sein zehnjähriges Gouverneurjubiläum feierte, hat der dem Außenminister Bene untertane èechische Blätterwald in den unflätigsten persönlichsten Beleidigungen gegen Admiral Horthy getobt, derart, daß sich sogar der diplomatische Vertreter Ungarns in Prag veranlaßt gefühlt hat, beim Außenministerium einzuschreiten, jedoch nur mit dem Erfolge, daß man ihm dort nach Angaben der Zeitungen die scheinheilige Aufklärung gab, daß dem Außenministerium kein Einfluß auf die Presse zustehe. Diese Aufklärung muß als falsch bezeichnet werden, was nachstehende Tatsachen bestätigen.
1. Als der unmittelbare Vorgänger des italienischen Konsuls in Mährisch-Ostrau wegen schwerer Angriffe auf die èechische Nation auf Verlangen der èechoslovakischen Regierung entfernt wurde, hat das èechoslovakische Justizministerium im Wege seiner bei den Staatsanwaltschaften fungierenden Zensurstellen allen inländischen Zeitungen bei Strafe der Konfiskationen verboten, über den Fall überhaupt zu schreiben. Tatsächlich brachte keine Zeitunng etwas über den Fall.

